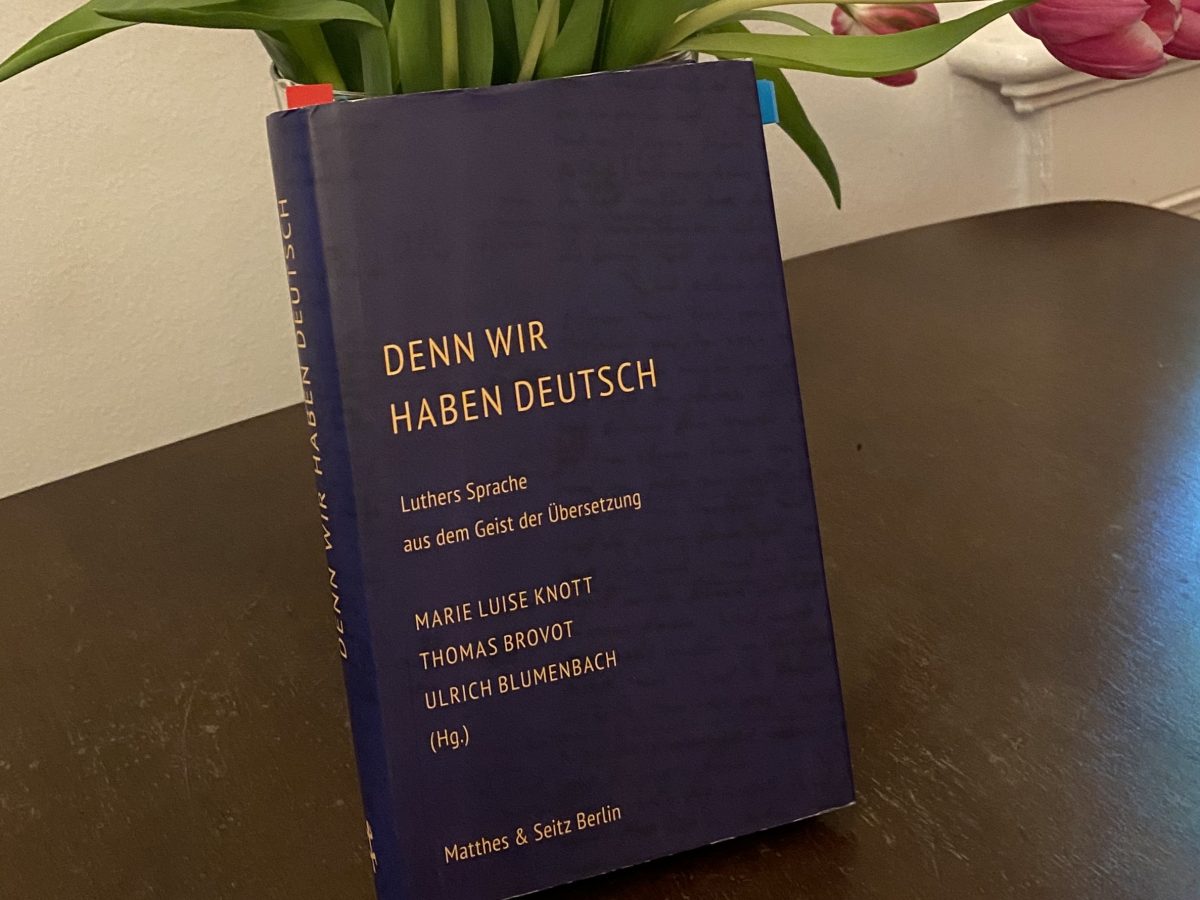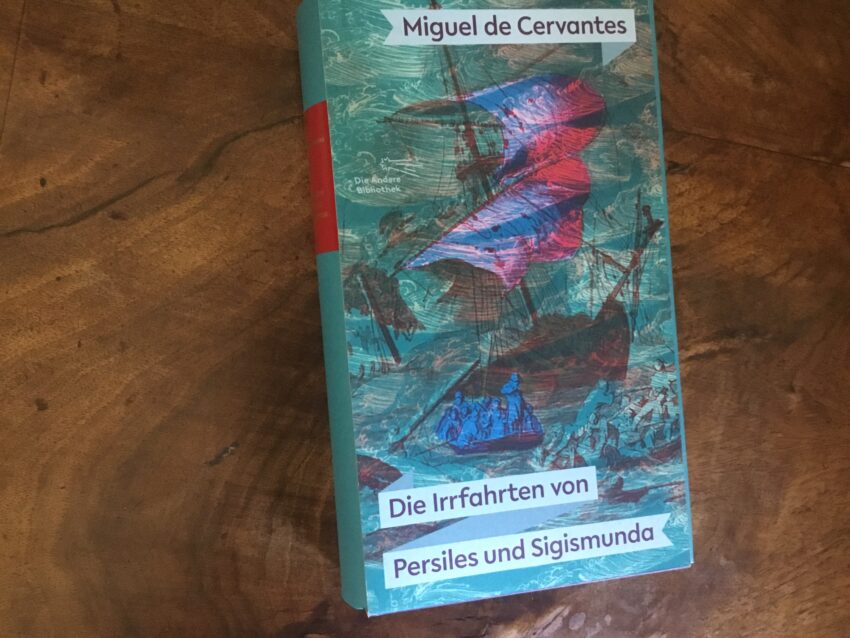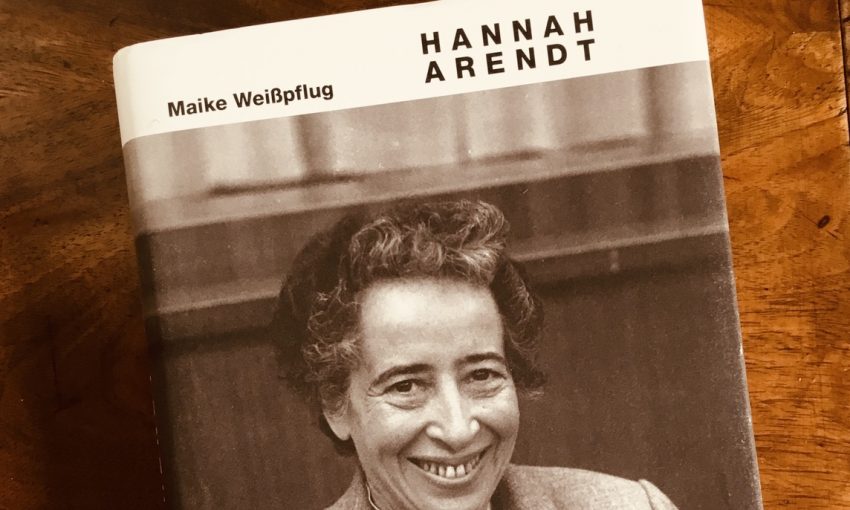Auf den Friedhöfen des Verstehens
- Marco Gutjahr
- 1. April 2019
- Bücher Lesen Rezension
Marie Luise Knott / Thomas Brovot / Ulrich Blumenbach (Hg.), Denn wir haben Deutsch. Luthers Sprache aus dem Geist der Übersetzung, Berlin: Matthes & Seitz 2015, 334 S.
Mit Beiträgen von Marcel Beyer, Anne Birkenhauer, Christian Hansen, Martina Kempter, Susanne Lange, Sibylle Lewitscharoff, Karl-Heinz Ott, Eveline Passet, Monika Rinck, Philipp Schönthaler, Kathrin Schmidt, Ulf Stolterfoht, Jan Wagner, Peter Waterhouse, Josef Winiger.
Übersetzer*innen sind seltsam unruhige Gestalten, auch wenn ihre sitzende Tätigkeit, die bisweilen an die Ungestalt der Gottesanbeterin erinnert, sie als Agent*innen einer Ruhe ausweist, deren Aufgabe darin besteht, eine Differenz zum Verschwinden zu bringen, die sie doch allererst an die Arbeit gehen lässt. Nichts verängstigt Übersetzer*innen offenbar mehr als eine holprige Formulierung, ein stockender Blick oder ein unterbrochenes Verstehen, wie Martin Luther im Sendbrief vom Dolmetschen zu berichten weiß: »Im Hiob erbeiteten wir also […], das wir yn vier tagen zu weilen kaum drey zeilen kundten fertigen. Lieber, nu es verdeutscht und bereit ist, kans ein yeder lesen und meistern. Laufft einer ytzt mit den augen durch drey, vier bletter und stost nicht ein mal an, wird aber nicht gewar, welche wacken und kloetze da gelegen sind, wo er ytzt uber hin gehet, wie uber ein gehoffelt bret, wo wir haben muessen schwitzen und uns engsten […].« Offenbar arbeiten Übersetzer*innen auf den Friedhöfen des Verstehens. Dies gilt ganz besonders, aber beileibe nicht ausschließlich, wenn die Sprachen, aus denen sie übersetzen, sogenannte tote Sprachen sind, Sprachen ohne Zukunft, für die ihre Übersetzung das einzige Versprechen auf Lebendigkeit darstellt. Übersetzen bestünde dann in einer »Zwiesprache mit den Toten« (74), um sie am Leben zu halten.
»Angestiftet vom Deutschen Übersetzerfonds« (12) versammelt der von Marie Luise Knott, Thomas Brovot und Ulrich Blumenbach herausgegebene Band Denn wir haben Deutsch. Luthers Sprache aus dem Geist der Übersetzung Beiträge von professionellen Literaturübersetzer*innen und Schriftsteller*innen, die — jenseits von religionswissenschaftlichen oder theologischen Ufern aus — einen Blick auf Martin Luther, den Übersetzer werfen. Dessen übersetzerisches Credo »denn ich habe deutsch […] reden woellen« wird schon im Titel des Bandes zu einem »Wir« verschoben, sodass ein einzelnes Übersetzen, so einsam diese Tätigkeit auch erscheinen mag, immer schon zum Resonanzraum mehrstimmiger und miteinander verwobener kultureller Lagen wird. Berücksichtigt man nun noch die Erfolgsgeschichte der lutherischen Bibelübersetzung, so liegt natürlich auch das politische Schlaglicht, das dieser Band in den Schatten der doch weitgehend marginalisierten Übersetzer*innentätigkeit wirft, nahe, wenn Luther als »Pate für die Übersetzung als Medium des europäischen Kulturtransfers« (15) angeführt wird.
Übersetzen, und im Folgenden nehme ich das übersetzerische »Wir« des Bandes ernst, ohne die beeindruckende Polyphonie seiner Beiträge unter eine Leitmelodie zwingen zu wollen, Übersetzen ist zunächst ein »unmögliches Unternehmen« (255). Unmöglich? Luther, dieser mächtige »Sprachschöpfer« (7), dieser »Sinnsucher« und »Dolmetscher« (15), der dem »furor interpretandi« (31) Verfallene, diese »eislebener zicke« (174), dieser Mann mit seiner unbändigen »Schöpfungslust« (250) wird hier als Übersetzer thematisiert, ohne dass das von ihm Übersetzte selbst vordergründig thematisch wird. Es geht nicht darum, in einen theologischen Disput über diese und jene Auslegung einzutreten, sondern vielmehr »mit großem Gespür, feinem Gehör und viel Sinn fürs Feinstoffliche« (12) die Praktiken des Übersetzers in den Blick zu bekommen, es geht um den Techniker Luther, auch wenn man sicherlich fragen müsste, inwiefern die technischen Aspekte des Übersetzens losgelöst von ihren inhaltlichen Untiefen betrachtet werden können. Während die literarischen Beiträge des Bandes davon naturgemäß nicht tangiert werden, versuchen die fachlichen Beiträge diese Schieflage durch ein bewährtes linguistisches Mittel auszugleichen, den Vergleich mit anderen Übersetzungen, seien sie nun vorlutherisch oder nachlutherisch oder gar lutherisch als eine Art Synopse der verschiedenen Revisionsstufen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Schlussfolgerungen der meisten Beiträge des Bandes zu einer positiven Würdigung des Übersetzers Luther gelangen, ja bisweilen werden sogar emphatische Lobgesänge laut, die eine Luther-Lektüre ausdrücklich empfehlen, um die ausgetretenen Pfade der Schulgrammatik verlassen und so die »sprachliche Ausdruckskraft wieder zum Leben erwecken« (160) zu können.
Dass hier eine Problemanzeige ans Licht kommt, der bisher kaum nachgegangen wurde, liegt auf der Hand. Worin besteht denn nun eigentlich die vielgerühmte Sprachmacht Luthers? Ist es nicht paradox, vom Frühneuhochdeutschen als einer »Grammatik«, die »noch in Bewegung« (134) sei, auszugehen, und gleichzeitig Luthers Lust am kalkulierten Bruch mit der Grammatik zu loben? Ist es nicht zumindest fragwürdig, die Schwierigkeit des lutherischen Projektes vor allem mit den unzähligen lokalen sprachlichen Varietäten zu begründen und gleichzeitig seine Verstöße gegen das sprachlich Übliche (welches denn? das zeitgenössische? das heutige gar?) zu würdigen? Würde nicht auch ein gründlicher Blick in die schriftsprachlichen Dokumente der Lutherzeit erbringen, dass das Luther-Deutsch, vielleicht abgesehen von seiner Lust an der Neubildung zugespitzter Komposita, nicht ganz so kreativ und erfinderisch war, wie bisher häufig angenommen wurde, sondern eher aus dem Vollen der zeitgenössischen Schriftsprache schöpfen konnte?
Aber auch wenn gründliche Untersuchungen in diese Richtung meines Erachtens noch ausstehen, so bleibt doch festzuhalten, dass die Beiträge des Bandes sich das »Paradies der gelungenen Übersetzung« (97) nicht grundsätzlich im Modell des »gehobelten Brettes« erhoffen. Schon das Original, der ausgangssprachliche Text, ist ein Text, der von Unebenheiten im Holz, von »Differenzen« wie man heute sagt, durchzogen ist. Von diesen Differenzen lebt also auch die Übersetzung, die diese nicht wegzuübersetzen hat, sondern vielmehr als »Gestaltungswillen« (110) zu erkennen geben muss. Die Übersetzung macht vielmehr sichtbar, was schon für jeden Text an sich gilt: »Sprache ist immer neu. Sprache übersetzt sich immer neu. Sprache muß immer übersetzt werden.« (210) Sprache und somit jeder Text existiert immer nur in einem Werden, in einer ruhelosen Bewegung, die die Ruhelosen schlechthin, die Übersetzer*innen bewegt. Sie sind das paradoxe Emblem einer Kultur der Gastfreundschaft, sie, die sich im Ausgangstext zwar heimisch fühlen, aber dort nur zu Gast sind. Sie, die die Fülle und die reichen Möglichkeiten des Originals spüren, das Sinnversprechen, das mit diesem einhergeht, und das ihnen schließlich, den Übersetzer*innen, in der Zielsprache angekommen, gegangen durch die lutherische Syntax etwa, dieser »Sinnerzeugungsmaschine« (191), wieder fremd wird, dort, wo sie doch eigentlich zu Hause sind.
Nur zu folgerichtig endet dieser sehr vielseitige und inspirierende Band mit einem zunächst befremdlichen Plädoyer: Luthers Bibelübersetzung »kann und darf man […] nicht revidieren« (317). Was rechtfertigt so ein vermeintlich überzogenes Ansinnen? War nicht schon Luther selbst sein erster und kritischster Revisor? Wie vielleicht für jede Übersetzung kann auch für Luthers Bibelübersetzung in Anspruch genommen werden, dass mit ihr (auch) der Raum der Literatur betreten wurde, dass sie ein »Kunstwerk« sei. Ein Kunstwerk kann man natürlich nicht revidieren, »man müsste es übersetzen« (317).
[Zuerst erschienen: Marco Gutjahr, »Rezension: Marie Luise Knott / Thomas Brovot / Ulrich Blumenbach (Hg.), Denn wir haben Deutsch. Luthers Sprache aus dem Geist der Übersetzung, Berlin: Matthes & Seitz 2015, 334 S.«, in: Ökumenische Rundschau, 66 (2017), Heft 1, S. 130-132.]